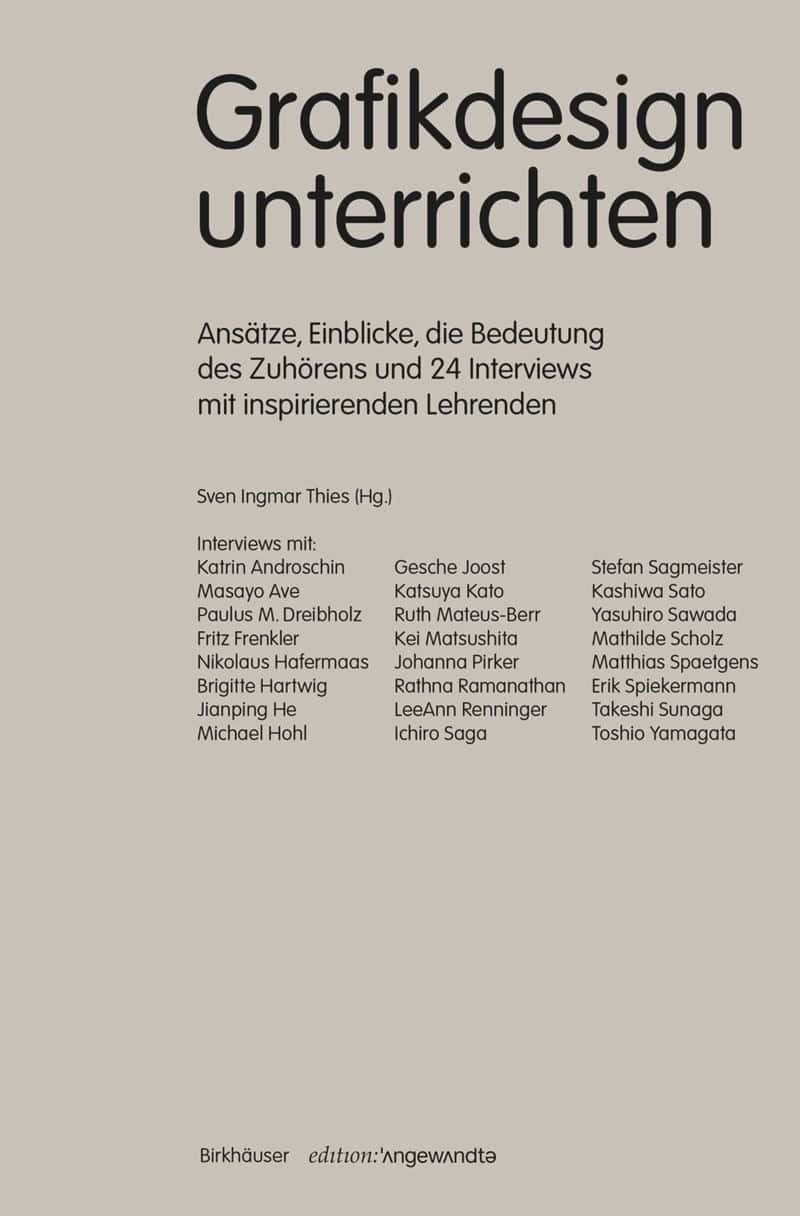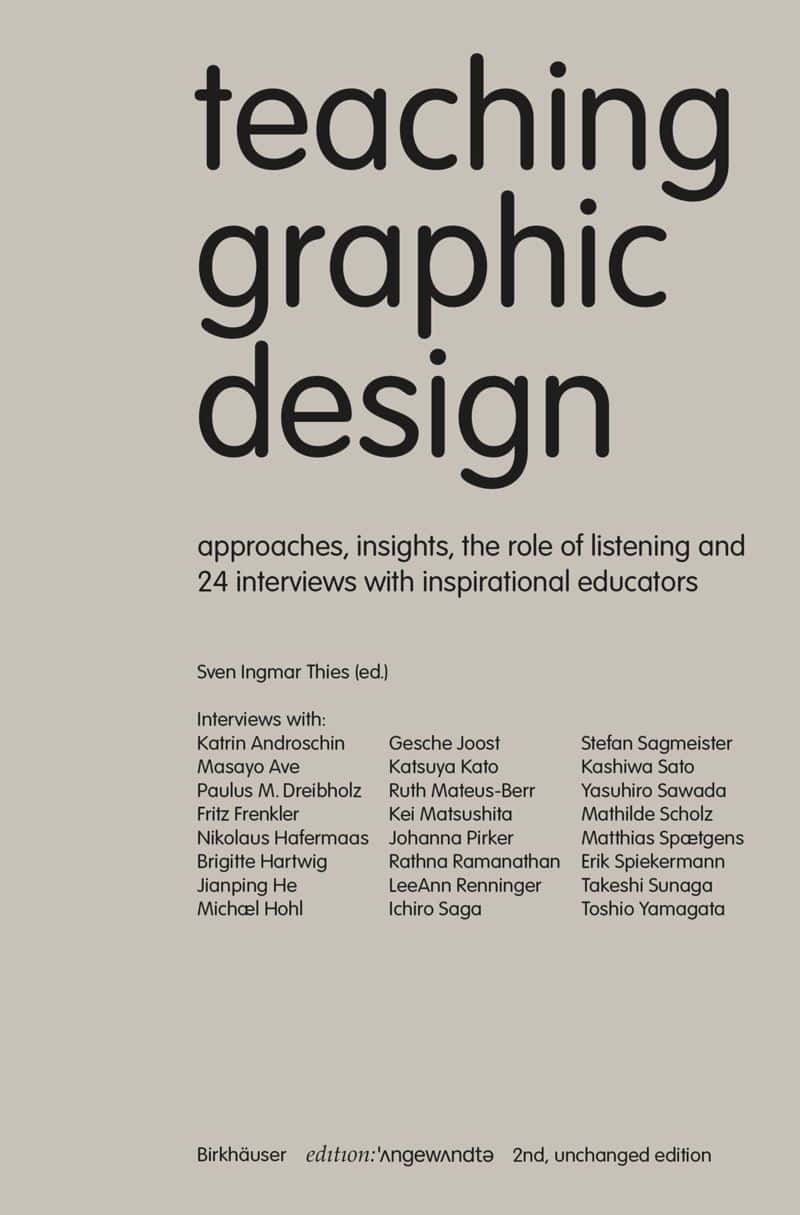Design lehren heißt Zuhören lernen: Sven Ingmar Thies im Gespräch
Was zeichnet guten Designunterricht aus – und warum ist ein offenes Ohr dabei mindestens genauso wichtig wie ein gutes Auge? Sven Ingmar Thies von der Universität für angewandte Kunst Wien teilt seine Einsichten über die Bedeutung des aktiven Zuhörens und berichtet, was er aus 24 Gesprächen mit internationalen Lehrenden gelernt hat.
Studierenden zuzuhören bedeutet mehr, als Inhalte abzufragen. Es heißt, über den Tellerrand hinauszuschauen, Empathie zu zeigen und das eigene Ego zurückzustellen. Davon ist der Grafikdesigner und Senior Artist Sven Ingmar Thies überzeugt. Im Frühjahr 2025 erschien Grafikdesign unterrichten, die deutsche Übersetzung seines Buchs Teaching Graphic Design, bei De Gruyter Brill.
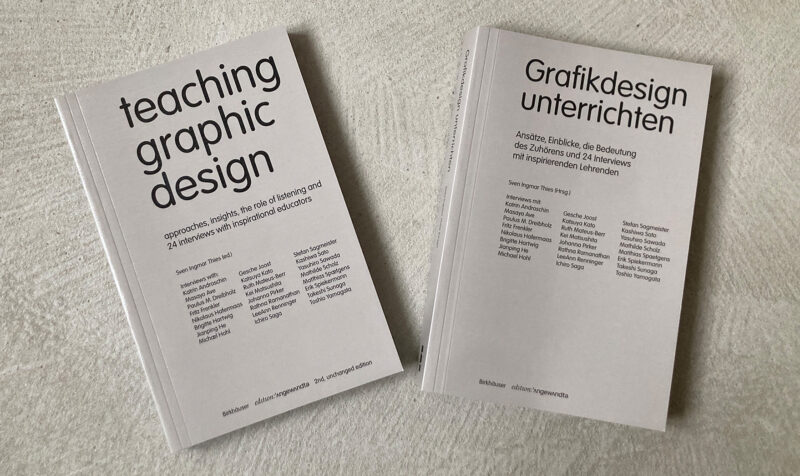
Der gebürtige Hamburger studierte Grafikdesign an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig und fertigte seine Abschlussarbeit in Tokio und Yokohama an. Nach Tätigkeiten in verschiedenen Markenagenturen gründete er 1998 sein eigenes Designstudio Thies Design. Neben seiner Arbeit in der Agentur unterrichtet er Grafikdesign in der Klasse für Ideen an der Universität für angewandte Kunst Wien.
Im Interview mit Alexandra Hinz von De Gruyter Brill reflektiert Thies über seine Erfahrungen an der Universität und darüber, was er aus Gesprächen mit 24 Designlehrenden aus Österreich, China, Deutschland, Japan, Großbritannien und den USA mitgenommen hat. Die Antworten hat er uns schriftlich zukommen lassen.
Alexandra Hinz: Herr Thies, wie sind Sie ursprünglich zum Grafikdesign gekommen?
Sven Ingmar Thies: Durch einen Werbetexter, der auf meinem Gymnasium seinen Beruf vorstellte. Neben einem Banker, einer Buchhalterin, einer kaufmännischen Angestellten und einer Ärztin erschienen mir er als Person und seine tägliche Arbeit am interessantesten. Außerdem war er der Einzige, der uns zum Lachen brachte – etwas, das auch im Unterricht wichtig ist.
Es folgte ein Praktikum in einer kleinen Werbeagentur, meine erste Studienplatzbewerbung in Hamburg, wo ich abgelehnt wurde, danach ein halbjähriger Mappenkurs und viel Dunkelkammerarbeit, da ich damals leidenschaftlich analog fotografierte. Bei der zweiten Bewerbung an der HBK Braunschweig klappte es dann. Ich studierte Grafikdesign und war von Anfang an neugierig auf andere Designdisziplinen. Das ist heute noch so. In meinem Studio „Thies Design“ reizen mich besonders die Projekte, die komplex sind und unterschiedliche Disziplinen verbinden. Sie führen zu gemeinsamen Erkenntnissen und Lösungen.
AH: Was hat Sie dazu bewegt, Teaching Graphic Design bzw. Grafikdesign unterrichten zu schreiben?
SIT: Ich wollte besser werden – überprüfen, ob das, was ich mache und wie ich es mache, gut für die Studierenden ist. In den über 12 Jahren, in denen ich Kommunikationsdesign und Kritisches Denken an der Universität für angewandte Kunst in Wien unterrichtet habe, tauschte ich mich intensiv mit Kolleg*innen aus und sprach auch viel mit Studierenden. Im Laufe der Jahre merkte ich aber, dass ich gerne über den Tellerrand der eigenen Uni, Österreichs und Europas hinausschauen wollte. Außerdem wollte ich mir bewusst Zeit nehmen, relevante Literatur zu lesen – etwas, das im Arbeitsalltag oft zu kurz kommt.
 AH: Nach welchen Kriterien haben Sie die 24 Interviewpartner*innen für Ihr Buch ausgewählt?
AH: Nach welchen Kriterien haben Sie die 24 Interviewpartner*innen für Ihr Buch ausgewählt?
SIT: Ich wollte von Anfang an nicht nur Grafikdesigner*innen interviewen, sondern auch hier über den Tellerrand – den meines Fachgebiets – hinausschauen, da das Unterrichten von Gestaltung keine scharf gezogenen fachlichen Grenzen aufweist und wir uns gegenseitig inspirieren. Mich selbstkritisch betrachtend, ist im Nachhinein der Buchtitel vielleicht nicht ganz richtig. Enthält das Buch doch auch Anregungen, zum Beispiel aus dem Industrial Design, der kognitiven Psychologie oder dem Game Design.
„Jeder Mensch ist interessant und hat etwas zu erzählen, wenn man sie oder ihn fragt.“
Einige Gestalter*innen kannte ich bereits, andere wollte ich schon immer mal sprechen und wieder andere wurden mir von Interviewpartner*innen empfohlen. Feste Kriterien gab es nicht. Jeder Mensch ist interessant und hat etwas zu erzählen, wenn man sie oder ihn fragt.
AH: Welche kulturellen Gemeinsamkeiten oder Unterschiede sind Ihnen im Laufe der Gespräche besonders aufgefallen?
SIT: Zunächst das Verbindende: Alle möchten Studierende durch Experimente, Erfahrungen und Erkenntnisse ihren eigenen Weg finden lassen.
Ein Unterschied, den fast alle japanischen Lehrenden betonten: Es braucht oft zwei Semester, bis Studierende, die aus einem sehr hierarchischen Schulsystem stammen, zum freien Denken und auch zum Widerspruch finden.
Nicht direkt kulturell, aber prägend sind Studiengebühren. In den USA zahlen Studierende hohe Summen bis zu ihrem Abschluss. Bildung wird dadurch anders bewertet und viele Studierende lernen zielbewusster. Das kann gut sein, aber führt manchmal dazu, weniger nach rechts und links zu schauen. Für mich ist das ein Nachteil, denn es bereichert, andere Disziplinen auszuprobieren oder Werkstattkurse zu besuchen – „Hand-zu-werken“.

AH: In Ihrem Buch betonen Sie die Bedeutung des „aktiven Zuhörens“. Was verstehen Sie darunter – und warum ist es Ihrer Meinung nach so wichtig?
SIT: Zuhören wird in der Lehre zu selten bewusst eingesetzt. Dies bestätigten mir fast alle Interviewpartner*innen und auch Studierende. In meiner Aufschlüsselung der Handlungsoptionen im Unterricht („fragen“, „zuhören“, „sagen“, „überdenken“ „machen lassen“) steht Zuhören daher im Zentrum meiner grafischen Darstellung.
„Zuhören wird in der Lehre zu selten bewusst eingesetzt.“
Wollte man den Begriff des „aktiven Zuhörens“ auf einen Satz verkürzen, trifft es die Aussage des Psychologen Michael P. Nichols sehr gut: „Das Wesensmerkmal guten Zuhörens ist Empathie – jene Einfühlung, die nur gelingt, indem wir unsere Ichbezogenheit hintanstellen […].“ Genau das ist entscheidend. Es geht um die Studierenden, nicht um uns Lehrende. Um diese Haltung erfahrbar zu machen und zur Reflexion eigener Situationen anzuregen, gebe ich im Buch Beispiele aus dem Unterricht.
AH: Gab es ein Interview oder eine Erkenntnis, die Sie auf besonders persönliche Weise berührt oder inspiriert hat?
SIT: Jedes Gespräch enthält wertvolle Anregungen. Wenn ich aber eine Situation hervorheben sollte, wäre es die Schilderung von Ichiro Saga von der Tama Art University in Tokio: „Einen Lehrer zu verlieren bedeutet, die eigene Zukunft zu verlieren. Mit seinem Tod hat die Gegenwart an Bedeutung gewonnen, während die Bedeutung der Zukunft abgenommen hat.“
Es gab eine erfreuliche Offenheit auf Seiten der Interviewpartner*innen, die weit über unsere Disziplin hinausging. Daher freute ich mich stets darauf, der nächsten Person zu begegnen.
AH: Haben Sie Ihre Herangehensweise an das Lehren durch die Arbeit an diesem Buch verändert?
SIT: Ja, nicht nur in der Lehre, sondern auch in meinem Studio. Ich treffe Entscheidungen und formuliere Aussagen bewusster, da mir der Prozess des Buchschreibens die Bedeutung präziser Sprache noch deutlicher gemacht hat.
“Im Annehmen von Feedback bin ich noch konsequenter geworden.”
Zuhören war dabei schon immer Grundlage meiner Arbeit – um Inhalte zu verstehen und den richtigen Fragen Raum zu geben. Daran hat sich nichts geändert. Was sich aber definitiv geändert hat, ist das Geben und Annehmen von Feedback. So frage ich nun öfter direkt nach einer Einheit, was gut lief, was nicht und was wir gemeinsam, wie auch jede einzelne Person, verbessern kann. Dies habe ich von Mathilde Scholz und Michael Hohl übernommen, die in ihrer Transformativen Lehre dadurch Verbesserungen sofort in die nächste Unterrichtseinheit einfließen lassen.
Und im Annehmen von Feedback bin ich noch konsequenter geworden: Es ist hinzunehmen. Man sollte nicht widersprechen. Klar kann man klärende Fragen stellen, aber es gibt keinen Grund sich angegriffen zu fühlen.
AH: Wie stellen Sie sich die Grafikdesign-Ausbildung im Jahr 2035 vor?
SIT: Ich stelle sie mir nicht konkret vor, weil ich Spekulationen in die Zukunft nicht mag. Ich bevorzuge den tatsächlichen Augenblick. Was ich aber weiß – oder eben auch nur spekulativ vermute – ist: Grafikdesign hat sich in seiner Geschichte stets neuen Techniken, Medien und gesellschaftlichen Anforderungen angepasst und wird das weiterhin tun.
Entscheidend bleibt die Offenheit für Neues und die Fähigkeit, Studierende zu Neugier und kritischem Denken zu ermutigen.
Erfahren Sie mehr im Buch, erschienen bei De Gruyter Brill
Englische Ausgabe
[Titelbild: Thies Design]