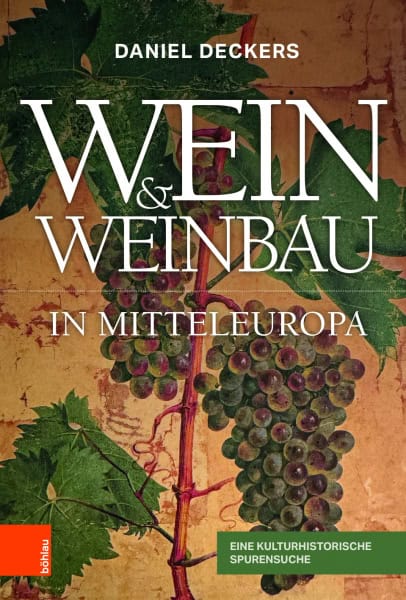„History in a bottle“: Daniel Deckers über Wein und Mitteleuropäische Geschichte
Wie prägten die Katastrophen des letzten Jahrhunderts den Wein in Mitteleuropa – und wie öffnet er heute wieder alte Grenzen? Mit Daniel Deckers schauen wir tief ins Glas der Geschichte.
Für Daniel Deckers sind Sauvignon Blanc, Blaufränkisch und Furmint – wie viele weitere Rebsorten auch – mehr als nur Genussmittel, mit denen sich der Tag angenehm beschließen lässt. Denn Wein lässt Landschaften erklingen und europäische Geschichte lebendig werden. Davon ist der FAZ-Redakteur, Lehrbeauftragte an der Hochschule Geisenheim und Autor des kürzlich erschienenen Buchs „Wein und Weinanbau in Mitteleuropa“ überzeugt.
Wie wirkten sich die Katastrophen des 20. Jahrhunderts auf den Weinanbau in Mitteleuropa aus? Kann Wein wieder zusammenführen, was einmal zusammengehörte? Und warum führte Deckers’ Spurensuche ihn sogar auf verfallene Friedhöfe im ehemaligen Sudetendeutschland? All das und mehr durfte Alexandra Hinz von De Gruyter Brill im Gespräch mit ihm erfahren.
Alexandra Hinz: Herr Deckers, bevor wir in Ihr neues Buch eintauchen, die Frage: Wann und wie ist Ihr persönliches und fachliches Interesse an dem Thema Wein und Weinanbau entstanden?
Daniel Deckers: Da kommen eine ganze Menge Zufälle ins Spiel. Ich habe als Jugendlicher und junger Erwachsener überhaupt keine Beziehung zum Wein gehabt. Ich bin mitten in Köln groß geworden, aber mir ist erst sehr viel später klar geworden, dass Köln das Weinhaus der Hanse war. Der legendäre Rheinwein, den es schon im Mittelalter gab, wurde in Köln gestapelt und von dort aus über den Rhein nach ganz Nordwesteuropa verschifft. Das habe ich erst gelesen, nachdem ich mit meiner Familie nach Limburg gezogen war. Von dort aus haben wir das Rheintal und auch die Terrassenmosel entdeckt.
“Wenn man sich die Mühe macht, unter solch extremen Bedingungen Wein zu erzeugen, muss er etwas sehr Besonderes sein.”
Über die Moselweine wusste ich in den 80er-Jahren wenig mehr, als dass sie wie die meisten Weißweine aus Deutschland „sweet and cheap“ waren, und vielleicht auch noch mit Glykol versetzt. Als ich aber zum ersten Mal unterhalb der imposanten Brücke stand, die bei Winningen die Mosel in einer großen Schleife überquert, und gewahr wurde, wie sich rechts und links kleine Terrassen wie Schwalbennester an den steilen Hang geklebt in die Höhe winden, da ist mir klar geworden: Wenn man sich die Mühe macht, unter solch extremen Bedingungen Wein zu erzeugen, muss er etwas sehr Besonderes sein. Auch die Verkostung in einem Weingut, das die Terrassenmosel wieder auf die Karten der Weinwelt gebracht hat, hat mich davon überzeugt, dass diese Weinkulturlandschaften viele Geheimnisse bergen – denen wollte ich auf die Spur kommen.
AH: In Ihrem Buch haben Sie sich mit der Geschichte des Weinbaus in Mitteleuropa ab der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart beschäftigt. Welche historischen Ereignisse haben die Weinkulturen in dieser Region besonders geprägt, und wie?
DD: Wenn man sich die europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts anschaut, könnte man – mit den Worten des tschechischen Schriftstellers Milan Kundera – sagen: Das Buch handelt, soweit es um das 20. Jahrhundert geht, im Wesentlichen von dem „entführten Westen“. Kundera meinte damit vor allem Regionen, die kulturell und politisch immer zum Westen gehörten, aber nach 1945 durch die europäische Teilung mit Gewalt hinter dem Eisernen Vorhang den westlichen Blicken entzogen waren.
“Ich wollte zeigen, dass es in den Grenzregionen eine ganz eigene Weinbaugeschichte gibt, die integraler Teil der europäischen Geschichte ist.”
Man kann dieses Bild aber auch etwas weiter fassen. Die Weinbaugebiete in Böhmen, Mähren, der nördlichen Slowakei oder im heutigen Burgenland, vormals Teil von Westungarn, die historische Steiermark, dazu Deutsch- und Italienisch-Tirol, das waren über Jahrhunderte nicht nur Grenzregionen, sondern Störungszonen, in denen sich immer wieder politische und kulturelle Spannungen entluden. Bis heute sind diese Teile Europas in der kollektiven Erinnerung nicht so präsent, dass man sie in Europas Mitte verortet. Dominant sind nach wie vor West und Ost als binäre Kategorien. Ich wollte dagegen zeigen, dass es in den Grenzregionen eine ganz eigene Weinbaugeschichte gibt, die integraler Teil der europäischen Geschichte ist.
Die westlichen Randzonen der Habsburgischen Doppelmonarchie haben durch die Implosion dieses Imperiums und die Herausbildung der Nationalstaaten 1918/1919 eine erste Zäsur erfahren. Man musste sich auf einmal in völlig neuen staatlichen Gebilden zurechtfinden. Traditionelle Absatzmärkte, Handelsrouten, kulturelle Verbindungen und Nachbarschaften waren mehr oder weniger über Nacht weggebrochen.
Knapp dreißig Jahre später dann eine zweite Zäsur: Die Vertreibung der Deutschen aus den Siedlungsgebieten in Mittel- und Osteuropa, in denen sie zum Teil seit dem Mittelalter ansässig waren. Wo die Deutschen waren, war aber auch Weinbau oft nicht weit. Das Vakuum, das sie hinterließen, wurde mit Neusiedlern gefüllt, die vom Weinbau wenig bis nichts verstanden. Die Kollektivierung der Landwirtschaft und die fabrikmäßige Herstellung von Wein führten dazu, dass das Wenige, was an Weinkultur vorhanden war, fast überall zugrunde ging.
Meine Frage war nun: Ist in den gut 35 Jahren nach Ende des europäischen Teilung zumindest räumlich wieder zusammengewachsen, was einmal zusammengehörte, so dass sich Grenzregionen im 21. Jahrhundert als Weinbauregionen in der Mitte Europas neu entdecken oder erfinden?
AH: Wie haben Sie denn für sich diese Fragen beantwortet? Gibt es nennenswerte grenzüberschreitende Initiativen?
DD: Ja! Einerseits ist es erschreckend, dass alte Konfliktlinien sich als kulturelle und politische Grenzen bis in die Gegenwart fortschreiben. Da und dort aber wird im Medium der Weinkultur eine längst verloren geglaubte Dimension europäischer Geschichte sichtbar – einer Geschichte, in der die Schrecknisse des 20. Jahrhunderts nicht so stark waren, dass diese Wurzeln komplett abgestorben wären.
“Da und dort wird im Medium der Weinkultur eine längst verloren geglaubte Dimension europäischer Geschichte sichtbar.”
Nach wie vor schwierig ist das Verhältnis zwischen Österreichern und Tschechen. Es gibt fast keinen Kontakt zwischen dem Weinviertel in Niederösterreich und dem angrenzenden Südmähren. Was man aber dort sehen kann, wo die gesamte weinbautreibende Bevölkerung 1945 innerhalb weniger Monate vertrieben wurde: Weingüter besinnen sich auf alte deutsche Flur- oder Lagenbezeichnungen zurück. Da steht auf einmal auf der Flasche „Goldhamer“ oder „Maidenburg“ statt „Děvín“.
Schwierig ist auch die Beziehung zwischen Österreich und Ungarn. Diese Spannung kam schon im 19. Jahrhundert massiv zum Tragen, besonders nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich, der der Magyarisierungspolitik auch in den mehrheitlich von Deutschen und Slowaken bewohnten Grenzregionen Tür und Tor öffnete. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sind die meisten Versuche gescheitert, von österreichischer Seite aus eine Brücke nach Ungarn zu schlagen. Umgekehrt gab es überhaupt keine Bemühungen. Inzwischen hat sich das Panorama ein wenig aufgehellt.
Ein ganz anderes Bild bietet sich in der historischen Steiermark, also dem heutigen österreichischen Bundesland und dem östlichen Teil der heutigen Slowakei mit ihrem alten und neuen Zentrum Marburg/ Maribor.
Seit der Gründung des (von Serben dominierten) Staates Jugoslawien 1918 gab es sogenannte Doppelbesitzer. Sie bewirtschafteten Rebflächen in Österreich und in Jugoslawien. Heute produzieren zwei Familien aus der Südsteiermark auf beiden Seiten der Grenze Weine auf Weltklasseniveau. Ich bin sicher, dass auch anderswo in Mitteleuropa das Potenzial für fine wines da ist. Man muss es nicht suchen, nur finden.
Wenn es die eine Erfolgsgeschichte in Mitteleuropa aus den letzten 30 Jahren gibt, dann ist es die Geschichte des Wiener Weins. Bis in die 90er-Jahre hinein war das Wenigste, das unter diesem Namen ausgeschenkt wurde, wirklich in Wien gewachsen – und auch das Wenigste genießbar. Heute erzeugen eine gute Handvoll Winzer, die im Verein „WienWein“ organisiert sind, Wein auf europäischem Spitzenniveau. Noch vor 30 Jahren trank man in der Wiener Gastronomie keinen Wiener Wein. Heute können die Weingüter gar nicht so viel produzieren, wie getrunken werden möchte, vor allem nicht von dem sogenannten „Gemischten Satz“.
AH: Wie sind Sie bei Ihrer Recherche vorgegangen? Haben Sie die Länder, die Sie im Buch behandeln, auch bereist?
“Manchmal kam ich mir vor wie ein Archäologe.”
DD: Ja. Zuvor habe ich versucht, mir ein Bild der Weinbaugeschichte im 19. und 20. Jahrhundert zu verschaffen, indem ich die Literatur, die es darüber gibt, ausfindig gemacht habe. Manches ist in entlegenen Monographien oder in Sammelbänden dokumentiert, nicht zu vergessen längst vergessene Zeitschriften. Ich bin dafür in Archiven, Bibliotheken und Museen von Leitmeritz über Prag und Wien, Brünn, Nikolsburg, Pressburg, Eisenstadt, Pettau und Marburg bis nach Bozen und San Michele gewesen. Immer wieder habe ich Dokumente in der Hand gehabt, bei denen ich mich gefragt habe, wer diese wohl zum letzten Mal in der Hand gehabt haben könnte, wenn überhaupt. In Prag liegt zum Beispiel eine deutschsprachige Weinzeitung, von der nur ein einziges Exemplar nachgewiesen ist.
Manchmal kam ich mir vor wie ein Archäologe, der versucht, anhand von allen möglichen Zeugnissen Spuren zu lesen – bis hin zu deutschen Vor- und Familiennamen auf verfallenen Friedhöfen im ehemaligen Sudetendeutschland: Mikrogeschichte(n), die wie unter einem Brennglas die ganze Tragik dieser Grenzregionen sichtbar werden lassen.
Ich bin also für alle Recherchen vor Ort gewesen und habe auch mit vielen heutigen Produzenten gesprochen. Manche Leute haben mir gesagt, dass ich ihnen gewissermaßen ihre Geschichte lesbar gemacht habe, wie sie diese vorher nie gesehen hatten und auch gar nicht sehen konnten. Dafür braucht es nicht nur das Handwerkszeug eines Historikers, sondern ein zumindest rudimentäres Wissen von Önologie [Lehre des Weins und Weinbaus]. Wenn man nicht weiß, wie Weinbau funktioniert, versteht man oft nicht, mit welchen Problemen sich Weinbauern und Wissenschaftler herumschlagen müssen und welche Bedeutung etwa Themen wie Rebenzüchtung oder Pflanzenschutz zukommt.
AH: Ist Ihnen bei Ihren Recherchen etwas ganz besonders in Erinnerung geblieben? Etwas, das Sie überrascht oder bewegt hat?
DD: Was mich immer wieder fasziniert hat, war die Schönheit und Weite der Weinlandschaften. Für mich waren alle Regionen anfangs terrae incognitae. Und im Medium des Weins werden diese Landschaften zum Klingen gebracht.
“Mir war es immer wichtig, die Menschen hinter dem Wein sichtbar werden zu lassen.”
Mir war es aber auch immer wichtig, die Menschen hinter dem Wein sichtbar werden zu lassen – diejenigen, die über Jahrhunderte oder Jahrzehnte hinweg von und mit oder auch für den Wein lebten. Es waren zum Teil unfassbar dramatische Geschichten, die mir erzählt wurden oder in schriftlichen Quellen zu finden waren. So habe ich zum Beispiel im Regionalarchiv von Maribor ein Verzeichnis der Schüler gefunden, die nach der deutschen Besetzung Jugoslawiens 1941 dort aufgenommen wurden, um Weinbau zu lernen. Das waren in der Regel Bauernsöhne. In den Zeugnissen finden sich Angaben zur Muttersprache, zur Konfession, zum Besitz des Vaters – und oft endet ein Eintrag mit: „eingezogen zum Reichsarbeitsdienst“ oder „eingezogen zur Wehrmacht“ oder „beim Bombenangriff verschüttet, tot ausgegraben“. Man spürt förmlich, wie diese oft blutjungen Männer in der Kriegsmühle der 1940er-Jahre gewissermaßen zermahlen wurden.
Dazu kommen Geschichten von jugoslawischen Partisanen, Überfällen auf Dörfer und Massengräber, die erst jüngst entdeckt wurden. Ohne diese „politischen“ Dimensionen mitzudenken, kann man über den Weinbau nicht schreiben.
AH: Wenn Sie ein „buchbegleitendes“ Weinpaket zusammenstellen könnten, welche Sorten würden Sie auswählen?
DD: Ich würde aus jeder Region einen charakteristischen Wein auswählen. Die höchste Qualität findet man in Slowenien – in der alten Steiermark – und im Burgenland. Ich würde auch einen Wein aus einem Kooperationsprojekt zwischen einem burgenländischen Winzer und einem ungarischen Kollegen hineinpacken. Außerdem gehört auf jeden Fall ein Wein aus den Kleinen Karpaten dazu. Südtirol und Trentino dürfen ebenfalls nicht vergessen werden.
Tatsächlich könnte man mit einem solchen Weinpaket eine „Weinreise“ unternehmen, die einen direkt in das Herz Europas führt. Guter Wein ist „geography in a bottle“, doch ich versuche, dieses Mantra um eine Dimension zu erweitern: Guter Wein ist immer auch „history in a bottle“.
Erfahren Sie mehr in diesem Buch
[Titelbild: piola666/E+/Getty Images]