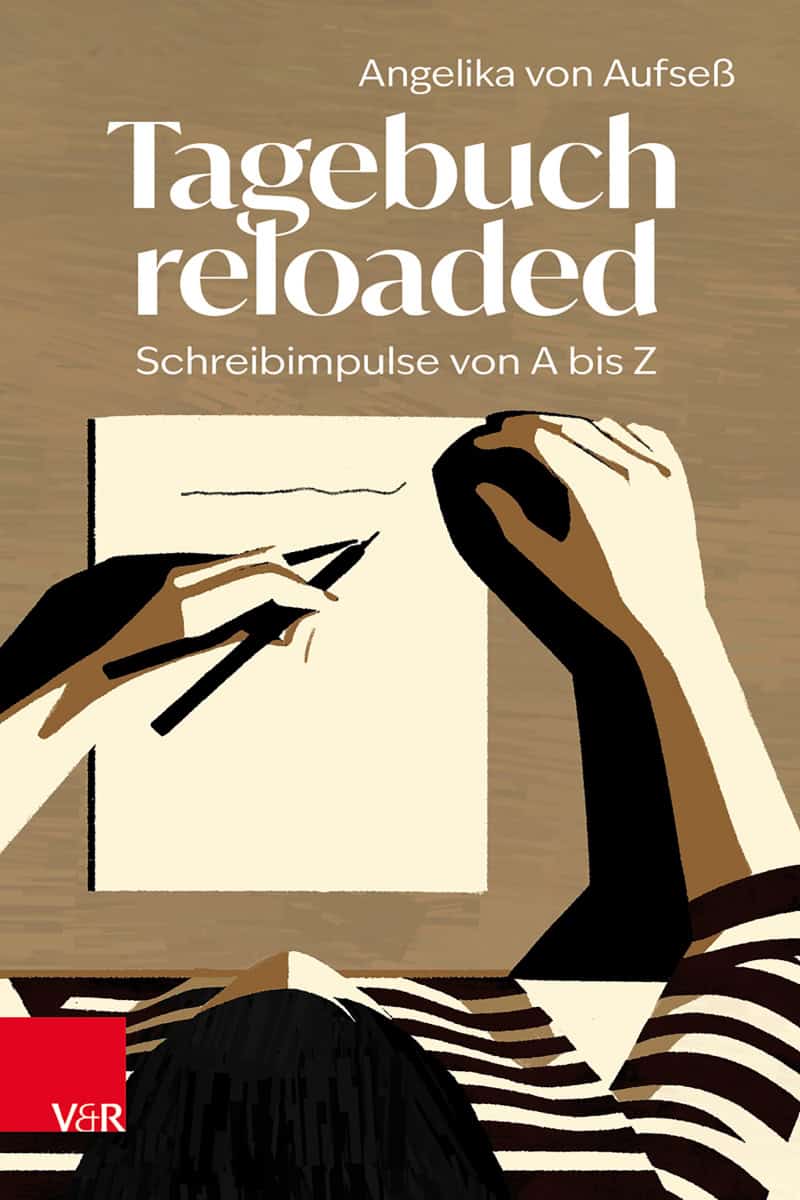Das Comeback des Tagebuchs – und warum es uns guttut
Thomas Mann und Virginia Woolf machten es vor – doch man muss keine berühmte Schriftstellerin oder kein gefeierter Schriftsteller sein, um seine persönlichsten Gedanken zu Papier zu bringen. In einer Zeit voller Hektik, Krisen und medialer Reizüberflutung lohnt es sich mehr denn je, zu schreiben statt zu scrollen. Es ist an der Zeit, das Tagebuch von seinem verstaubten Image zu befreien!
Warum in aller Welt sollten Sie ein Tagebuch führen oder nach langer Zeit wieder damit beginnen? Tagebuchschreiben klingt nach Routine, Ritual, Regelmäßigkeit. Nach einem Buch oder einem Heft, das man jeden Tag aufschlägt, egal wie ereignislos der Tag war und wie trostlos der Text ist, den man weder aufschreiben noch jemals wieder lesen will.
Außerdem sind Sie vermutlich kein unglücklich verliebtes Mädchen, das seinen Kummer ins Tagebuch kübelt, kein Kirchenvater, der seine Bekenntnisse notiert, kein*e Schriftsteller*in, deren wohlgesetzte Worte in einer späteren Veröffentlichung ihre Leser*innen finden werden. Und es rast die Zeit. Da gibt es keine Lücke für schriftliche Reflexion des Seins und Tuns.
Oder ist etwa das schon ein Grund zum Schreiben an sich selbst?
Entschleunigung
Im Tagebuch feiern wir den Augenblick. Nichts zählt außer dem, was in diesem Moment im Innen und im Außen wahrnehmbar ist. So kann im besten Fall der Moment, in dem der Stift sich über die Seiten schiebt, zu einer Insel der Entschleunigung werden, zu einem Moment von Flow, einem genussvollen Sein im Hier und Jetzt.
Die Zeit anhalten, Atmen, das Leben zulassen.
Entlastung
Die Schriftstellerin Virginia Woolf nutzte ihre Sprachmächtigkeit nicht zuletzt zur eigenen Entlastung: „Ich möchte mich niederlegen wie ein müdes Kind und dieses sorgenvolle Leben hinweg weinen – und mein Tagebuch wird mich auf seine Daunenkissen betten“, schrieb sie 1925. Wer eine Neigung zu Verstimmungen hat, kann im Tagebuch Unterstützung finden. Das Aufschreiben von Gefühlen und die Beschreibung beängstigender oder bedrückender Situationen hilft bei der Distanzierung und führt im besten Fall zu emotionaler Stabilisierung.
“Wer eine Neigung zu Verstimmungen hat, kann im Tagebuch Unterstützung finden.”
Der amerikanische Psychiater Daniel Siegel (*1957) prägte den Satz „Name it to tame it“ und wies in Studien nach, dass die Benennung belastender Gefühle zur Reduktion von Stress führt. So schien auch Arthur Schnitzler (1862–1931) bereits davon gewusst zu haben. Er bezeichnete das Tagebuch als „Spucknapf seiner Verstimmungen“ und beschrieb damit die entlastende Funktion des Schreibens.
Hier sind einige Empfehlungen für angehende Tagebuchschreiber*innen:
- Geben Sie sich die innere Erlaubnis, ohne Zensur das zu Papier zu bringen, was da ist – ohne Rücksicht auf Tabus, spätere Leser*innen oder Ansprüche an Form und Inhalt.
- Achten Sie auf Ihre eigenen Grenzen und legen Sie den Stift beiseite, wenn der emotionale Druck zu hoch wird.
- Arbeiten Sie mit Distanzierungstechniken, wie z.B. dem Perspektivwechsel. Anstelle der Ich-Form verwenden Sie die 3. Person Singular und beschreiben das traumatische Ereignis aus der Helikopterperspektive. Oder Sie schreiben ganz bewusst im Duktus eines Chronisten: detailliert, sachlich, faktenbasiert. Ohne Emotion und innere Beteiligung.
Ressourcenstärkung
„In den Tiefen des Winters erfuhr ich schließlich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer liegt.“ So skizzierte Albert Camus (1913–1960) eine Haltung, die wir heute als Resilienz bezeichnen würden. Die Fähigkeit, sich in schweren Zeiten auf das zu konzentrieren, was Halt gibt, was an inneren und äußeren Ressourcen zur Verfügung steht.
Im Schreiben an mich selbst begegne ich mir auf ungewöhnliche Weise. Ich kann die Kraft der Sprache für die Suche nach dem unbesiegbaren Sommer in mir einsetzen. Ich nutze Papier und Stift als Spielwiese, auf der sämtliche Verbotsschilder entfernt wurden und kläre meine Gefühle, Gedanken und Beziehungen schreibend.
“Im Schreiben an mich selbst begegne ich mir auf ungewöhnliche Weise.”
Zahlreiche Studien belegen, dass die bewusste Fokussierung auf die eigenen Stärken sowie auf positive Erfahrungen und Bewältigungsstrategien die psychische Widerstandskraft erhöhen. Am bekanntesten sind hier die Dankbarkeits- und Erfolgstagebücher, die den Blick auf die hellen Seiten des Lebens trainieren. Die Professorin Dr. med. Silke Heimes schreibt dazu in ihrem Buch Warum Schreiben hilft: „Das bedeutet nicht, dass schwierige Gefühle außer Acht gelassen werden, sondern dass der Blick geweitet und auch das in den Fokus genommen wird, was stärkt und das Leben lebenswert macht.“
Dokumentieren
Doch nicht immer geht es um Entlastung oder Ressourcenaktivierung. Nicht alle Schreibenden betrifft die folgende Charakterisierung von der amerikanischen Journalistin und Schriftstellerin Joan Didion (1934–2021): „Besitzer von Notizbüchern gehören zu einem anderen Menschenschlag, sie sind einsam und widerborstig und müssen die Dinge ständig neu sortieren, sie sind ängstlich und unzufrieden, Kinder, die anscheinend schon bei ihrer Geburt eine Vorahnung von Verlust befallen hat.“
Das dokumentierende Tagebuchschreiben, korrekterweise nennt man es besser ein Journal oder eine Chronik, eignet sich vor allem für Menschen, die ihre Umwelt mit wachen Augen und scharfem Verstand verfolgen. Sie wollen Erlebtes festhalten, häufig auch kommentieren. Der Gedanke an eine interessierte Nachwelt schwingt mit. Faktenschreiber tragen eine Mission in sich: Was sie erleben, wie sie es erleben und – last but not least – wie sie es in Worte fassen, muss auch für andere interessant sein. Davon sind sie überzeugt.
“Nicht nur dramatische Ereignisse in der äußeren Welt verlangen nach Verschriftlichung. ”
So umfasst das Tagebuch von Harry Graf Kessler (1868–1937) über zehntausend Seiten. Zwischen 1880 und 1937 schrieb der Diplomat und Kunstmäzen über die Welt um ihn herum. Ohne zu psychologisieren oder eigene Befindlichkeiten ins Spiel zu bringen. Ihn interessierten die Ereignisse und die Menschen. Doch nicht nur dramatische Ereignisse in der äußeren Welt verlangen nach Verschriftlichung. Selbst große Geister wie Thomas Mann (1875–1955) notierten kleine, alltägliche Episoden im Tagebuch: „Kopfwäsche mit nachfolgender Anwendung zu starken französischen Haarwassers. Der Reiz und die Austrocknung bewirken für den ganzen Tag ein unangenehmes Gefühl.“
Tagebuch Reloaded
Ich möchte dazu einladen, das Tagebuch neu zu definieren und es zu einem Ort zu machen, der sowohl das eigene Leben bereichert als auch hineinpasst in dieses fleißige, volle, schwierige, wundervolle Leben.
Ob wir das Leben bejammern, es feiern, ob wir die gelebte Zeit dokumentieren, kommentieren, ihre Essenz lyrisch verdichten, ob wir Banalitäten produzieren oder Erkenntnisse festhalten: Geben wir uns die Erlaubnis, den Staub vom vorgefertigten Tagebuch-Image zu pusten und es nach unseren eigenen Bedürfnissen und unserem individuellen persönlichen Stil mit Inhalten zu füllen.
Wie Peter Rühmkorf (1929–2008), der seine Innen- und Außenwelt in den Tagebüchern Tabu I und Tabu II schreibend erkundete, sagen würde: „Das Tagebuch: das unqualifizierte ressentimentale Gebrummse, mit dem man den Tagesablauf begleitet. Das Schicksal. Das Wetter. Die Nachrichten.“
Tauchen Sie tiefer ein in die Welt des Tagebuchschreibens – mit diesem Ratgeber
[Titelbild: Milko/E+/Getty Images]