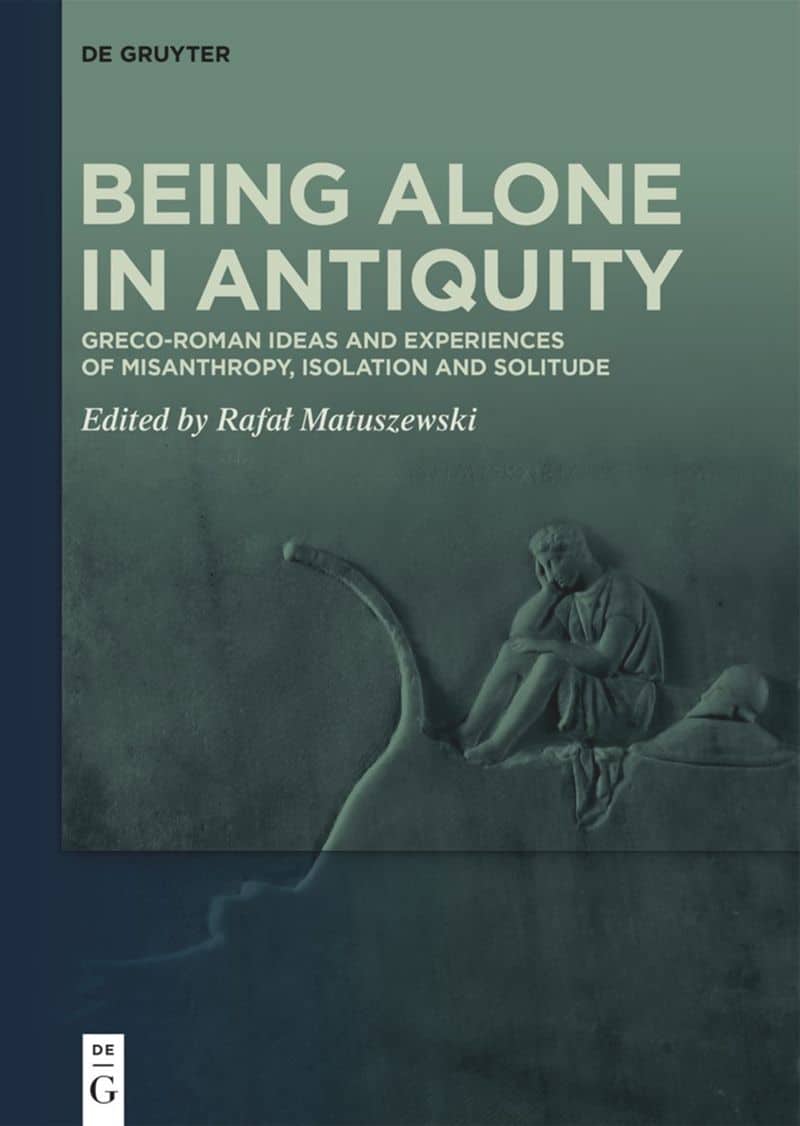Tausende Jahre Einsamkeit: Antike Perspektiven auf ein hochaktuelles Problem
Schon lange vor COVID-19 entwickelte sich die „Einsamkeitsepidemie“ zum Thema zahlreicher Debatten, doch heute ist das Problem aktueller denn je und regt zum Nachdenken darüber an, was die Einsamkeit mit sich bringt. Ist der Mensch wirklich, wie Aristoteles es ausdrückte, ein von Natur aus auf die Gemeinschaft mit anderen angewiesenes Wesen?
Über 7,9 Milliarden Menschen bevölkern derzeit die Erde. Anfang 2021 waren es rund 95 Millionen Personen mehr als noch ein Jahr zuvor. Paradoxerweise: je enger es auf der Welt wird, desto einsamer und isolierter fühlt man sich. Diese Tendenz hat sich während der aktuellen Coronakrise deutlich verstärkt, weshalb das Thema Einsamkeit noch mehr in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt ist.
Europäische Statistiken schlugen allerdings bereits vor dem Ausbruch der Corona-Krise Alarm. Nach einer Studie von Eurostat aus dem Jahre 2017 fühlten sich sechs Prozent der europäischen Bevölkerung über 16 Jahren alleingelassen, in anderen Umfragen bezeichneten sich 18 Prozent der Europäer als sozial isoliert. Eine neuere Befragung des Eurofound (2021) hat ergeben, dass sich sogar ein Viertel der Menschen in Europa in den ersten Monaten der Coronavirus-Pandemie einsam gefühlt hat. Eines ist klar: Unter dem Alleinsein leiden heute – und litten auch in der Vergangenheit – Millionen von Menschen.
Im Kampf gegen dieses folgenreiche Phänomen wurden in etlichen Ländern bereits diverse Maßnahmen gesetzt: In Frankreich verkündete man den Kampf gegen Einsamkeit als „großes nationales Anliegen“ (Grande cause nationale) für das Jahr 2011, in Großbritannien ernannte man 2018 sogar eine Staatssekretärin für Einsamkeit (Minister for Loneliness). Auch in anderen europäischen Ländern entwickelt man seit einiger Zeit Strategien zur Enttabuisierung, Bekämpfung, Verringerung und Prävention von Einsamkeit und sozialer Isolation.
“Alleinsein kann bisweilen auch als eine heil- und lustvolle Erfahrung gesucht, aktiv initiiert und genossen werden.”
Während an der einen Front ein eifriger Kampf gegen das Alleinsein geführt wird, wird auf der anderen von nicht wenigen Menschen von Momenten der Einsamkeit geträumt. Denn Alleinsein kann nicht nur als ein stets tragischer Zustand erlitten werden, es kann bisweilen auch als eine heil- und lustvolle Erfahrung gesucht, aktiv initiiert und genossen werden. Diese ambivalente Betrachtungsweise und Bewertung von Einsamkeit ist – wie das Phänomen selbst – freilich kein Novum. Bereits in antiken Quellen finden sich erhellende Belege für beide Seiten.
Einsamkeit im Alter: Eine Schattenseite der Langlebigkeit
Wer kennt die „Trunkene Alte“ nicht? Die in der Münchner Glyptothek aufgestellte Skulptur zieht die Aufmerksamkeit wohl aller BesucherInnen auf sich. Es ist auch leicht einzusehen, warum. Von den typisch griechischen schönen, idealen Körpern oder graziösen und gelassenen Posen ist hier nichts zu sehen. Was man dagegen vor die Augen bekommt, ist in ihrer lebendigen Anschaulichkeit anrührend, wenn nicht gar erschütternd.

Eine faltige, abgemagerte, abschreckend aussehende Greisin wird auf dem Boden sitzend, mit vorne überkreuzten Beinen, dargestellt. Im Schoß hält sie – eng umschlungen, beinahe wie eine Mutter ihr geliebtes Baby – ein großes Weingefäß. Der in den Nacken geworfene Kopf, der offene Mund, dem offenkundig lallende Geräusche entfahren, und das von einer Schulter herabgeglittene und auf der welken Brust flatternde Gewand zeigen deutlich, dass die so dargestellte Greisin bereits eine gehörige Dosis vom Inhalt des Gefäßes zu sich genommen hat.
Die durch ihre Dramatik rührende Skulptur schockiert umso mehr, als sie als Gegensatz all dessen erscheint, was bei den Griechen als Ideal des Weinkonsums galt. Sollte der Konsum der Gabe des Gottes Dionysos denn nicht in geselliger Runde stattfinden? Ging es dabei denn nicht in erster Linie um das Pflegen sozialer Kontakte und Verhaltensweisen? Und zwar um das gesellige Beisammensein exklusiv unter Männern?
In der Tat. Die in der Münchner Glyptothek aufbewahrte Skulptur – wie Angelos Chaniotis kürzlich anschaulich darlegte – zeigt aber keinen Mann, sondern eine Frau. Keine schöne wie die bei Symposien auftretenden Hetären und Aulosspielerinnen, sondern eine hässliche Greisin, die den Wein nicht auf einem Ruhebett liegend, sondern auf der Straße sitzend zu sich nimmt und die den Trunk obendrein mit niemanden teilt, sondern ihn ganz alleine auskostet. Die einsame alte Frau, so elend sie auch erscheinen mag, scheint ihr Alleinsein dennoch in gewisser Weise zu genießen.
Allerdings scheint für die meisten, heute wie in der Vergangenheit, das einsame Alter wenig genussreich zu sein. Alleine die Aussicht auf ein einsames Greisenalter kann derart erschreckend erscheinen, dass sie bisweilen zu manch vorsorglichen Schritten oder Präventivmaßnahmen anregt.
In der antiken Welt konnte etwa die Investition in Sklavinnen und Sklaven, insbesondere in die Hausgeborenen, eine sinnvolle Lösung darstellen, wie uns etwa der Fall einer im römischen Ägypten im 1. oder 2. Jahrhundert n. Chr. lebenden Frau gut zeigt. Thermoution, so hieß sie, kümmerte sich schon verhältnismäßig früh in ihrem Leben darum, sich Unterstützung für ihren Lebensabend zu sichern. Sie gesteht in einem an den Strategen von Oxyrhynchos gerichteten Schreiben, dass sie – eine hilflose und alleinlebende Frau (gynaika aboetheton ousan kai monen) – all ihre Hoffnungen auf ihre hausgeborene Sklavin names Peina gesetzt hatte, um die sie sich so kümmerte als wäre Peina ihre eigene Tochter. Davon erhoffte sich Thermoution, dass ihr Peinas Unterstützung und Gesellschaft im Alter sicher wäre.
Diese Pläne und Hoffnungen schien allerdings ein Unfall untergraben zu haben, bei dem sich Peina eine offenkundig schwere Handverletzung zugezogen hatte. Im Endeffekt machte dieses Missgeschick – wie dem Schreiben von Thermoution zu entnehmen ist – die alternde Frau unsicher und ängstlich (vielleicht wahrhaft oder vielleicht nur vorgeblich, um eine Entschädigung zu erhalten). Das körperlich behinderte Mädchen würde nicht in der Lage sein, ihr in den schwierigen und einsamen Jahren des Lebensherbstes die erforderliche Unterstützung zu gewähren. Thermoutions Besorgnis und ihre frühzeitige und umsichtige Vorbereitung auf den Lebensabend kommen uns auch heute – nach fast 2000 Jahren – erstaunlich vertraut vor.
Muss man allein sein, um einsam zu sein?
Und doch, trotz dieser verblüffenden Ähnlichkeiten, wirkt die antike Welt für uns in vieler Hinsicht zutiefst befremdlich, gelegentlich sogar abstoßend. Die Existenz der Sklaverei etwa ist hierfür nur ein Beispiel von unzählig vielen – selbst wenn es (wie wohl eher selten) solche SklavenhalterInnen wie Thermoution gab, die ihre Unfreien liebevoll behandelten. Aber gerade das Phänomen der Sklaverei lädt zum Nachdenken darüber ein, ob es in einer Gesellschaft wie der antiken, in der Sklaven überall verbreitet waren, überhaupt möglich war, jemals wirklich allein zu sein.
Ein besonders instruktives Fallbeispiel bietet eine athenische Gerichtsrede, die um 390 v. Chr. von Lysias verfasst wurde. In jener Rede schildert der Redner die Ereignisse, die zu einem auf ihn ausgeübten Überfall, dem Gegenstand des Prozesses, führten, und erklärt, dass er den Angreifern begegnete, als er allein unterwegs war (ego monos badizon). Doch aus einer weiteren Passage seiner Rede geht klar hervor, dass er damals, bei jenem alleinigen Spaziergang, von einem Sklaven begleitet wurde! In ähnlicher Weise genossen (und betonten) viele römische Villenbesitzer ihre Abgeschiedenheit und „Einsamkeit“ auf dem Land, obwohl sie dort wohl stets von Unfreien umgeben waren, die freilich jederzeit bereit waren, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen.
“Da Sklaven im antiken Griechenland und Rom als Nicht-Personen begriffen wurden, wirkte sich ihre quasi ‘unsichtbare Präsenz’ nicht auf die ‘Privatsphäre’ der Freien oder deren ‘Einsamkeit’ aus.”
Diese Beispiele lassen gut erkennen, dass sich unsere moderne Vorstellung von der Einsamkeit und dem Alleinsein von den antiken Denkweisen weitgehend unterscheidet: Da Sklaven im antiken Griechenland und Rom als Nicht-Personen begriffen wurden, wirkte sich ihre quasi „unsichtbare Präsenz“ nicht auf die „Privatsphäre“ der Freien oder deren „Einsamkeit“ aus. Ein Athener konnte demzufolge wohl behaupten, er sei allein spazieren gegangen, auch wenn er sich zu diesem Zeitpunkt in Begleitung eines Sklaven – nach unserem Verständnis also nicht allein – befand.
Alleinsein für Menschen des griechisch-römischen Altertums bedeutete folglich mitunter etwas Anderes als Alleinsein in unserem modernen Sprachgebrauch. Antike Denkweisen, auch wenn sie uns auf den ersten Blick so offensichtlich und selbstverständlich erscheinen, können nicht unbedingt und nicht immer mit der modernen Vorstellung davon gleichgesetzt werden.
Begriffsfalle: Täuschende Worte, fehlende Konzepte?
Dass Worte täuschen und Aussagen aus der Vergangenheit leicht missverstanden werden können, lassen auch weitere Überlegungen über die Einsamkeit erkennen. Denn was man im Deutschen „Einsamkeit“ nennt, lässt sich etwa im Englischen je nach der angestrebten Bedeutungsebene durch verschiedene Substantive ausdrücken, darunter solitude, loneliness oder lonesomeness.
Unterschiedliche Begriffe für das Alleinsein findet man zwar auch im Altgriechischen und Lateinischen, aber keine dieser Sprachen kennt einen Begriff, der – wie das englische Wort loneliness – die subjektiven emotionalen Zustände ausdrücken würde. Zur Bezeichnung der Einsamkeitsempfindungen begann man jenen englischen Begriff allerdings erst im ausgehenden 18. Jahrhundert zu gebrauchen.
Genauso wie Robinson Crusoe (1719) in all seiner Einsamkeit nie über die loneliness klagt, weil ihm in der englischen Sprache von damals der passende Begriff schlicht fehlte, so werden auch die bohrende Einsamkeit und bittere Verlassenheit des auf der Insel Lemnos ausgesetzten griechischen mythischen Helden Philoktet von dem athenischen Tragödiendichter Sophokles (409 v. Chr.) durch eine etwas merkwürdige paradoxe Umschreibung ausgedrückt: Philoktet sei „sein eigener Nachbar“.

Der psychologische und emotionale Zustand des Alleinseins, die Empfindung von Leere, Verzweiflung, Traurigkeit, gehörte freilich zur Erlebniserfahrung der antiken Griechen und Römer. Trotzdem ließ er sich weder einfach noch eindeutig in Worten ausdrücken.
Einsamkeit ist nicht gleich Einsamkeit
Die Einsamkeit ist ein subjektives Gefühl und wird von jedem Menschen anders wahrgenommen – und sie ist generell je nach Umständen verschieden. So beklagte etwa der römische Redner, Politiker und Philosoph Cicero die erzwungene Isolation nach seiner Flucht aus Rom im Jahr 58 v. Chr. bitterlich, dagegen vermied er in der Zeit nach dem Tod seiner Tochter im Jahre 45 v. Chr. von sich aus jeden menschlichen Kontakt und suchte freiwillig die Einsamkeit auf.
Während im ersten Fall – des Exils – die erzwungene Einsamkeit (solitudo) ungemeinen Schmerz (dolor) verursachte, wurde die freiwillige solitudo während der Trauerzeit von Cicero positiv bewertet, da sie als Mittel zur Linderung seines dolor angesehen wurde. So breit und vielfältig das Erfahrungs- und Erlebensspektrum der Einsamkeit in der Antike sein konnte, so unterschiedlich waren auch die Gründe für ihre Entstehung und so vielfältig ihre Formen.
“Völlige physische Isolation war in der Antike durchaus schwer zu erreichen, sehr mühsam über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten und wurde grundsätzlich als moralisch und auch physisch gefährlich betrachtet.”
Eines ist allemal sicher: Völlige physische Isolation war in der Antike durchaus schwer zu erreichen, sehr mühsam über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten und wurde grundsätzlich als moralisch und auch physisch gefährlich betrachtet. Sicherer und lohnender war die von manchen Philosophen empfohlene „innere“ Einsamkeit, die darin bestand, sich in den eigenen Geist zurückzuziehen, sei es durch Lesen, Schreiben oder Meditation, und sich dergestalt einen von der äußeren physischen Welt getrennten geistigen Rückzugsort zu schaffen, der jederzeit und überall betreten werden konnte.
Solch eine innere, introvertierte Einsamkeit eines Seneca oder Mark Aurel war freilich in jeder Hinsicht anders als etwa die reale, erzwungene Einsamkeit Ciceros, Ovids und anderen zahlreichen antiken Exilierten. Auch die freiwillige physische Absonderung, wie die der Misanthropen oder christlichen Asketen und Eremiten, nahm unterschiedliche Zwischenformen an und war verschiedentlich motiviert.
Ein von nicht wenigen Einsiedlern der Antike erlebtes Paradox war folgendes: je mehr sie die Einsamkeit suchten, desto mehr Menschen zogen sie an. Die asketische Praxis des Säulenstehers Symeon Stylites des Älteren (4./5. Jh. n. Chr.) etwa, der mehrere Jahrzehnte seines Lebens auf einer Säule verbrachte, zog Unmengen von Schaulustigen an. Die Wildnis und Einöde, in die so viele Eremiten zogen, um sich in der Einsamkeit durch Askese, Buße und Gebet von der diesseitigen Welt frei zu machen, wandelte sich zuweilen recht schnell in dicht besiedeltes Gebiet um. So ist die gewünschte, menschenferne Einsamkeit der christlichen Anachoreten nicht selten durchaus relativ gewesen.

Außerdem bedeutete das angestrebte Alleinsein für viele Asketen die innige Versenkung in Gott, die Einsamkeit galt demzufolge als Weg zu Gott, wenngleich für andere antike Eremiten oder Einsamkeitssuchende (darunter Dichter und Gelehrte) andere Motive ausschlaggebend waren. Soziale Isolation wurde folglich nicht immer als ein unheilvolles Phänomen bekämpft, sondern mitunter als Weg zur Offenbarung gesehen, als Weg zur dichterischen Inspiration, als Weg zu sich selbst, als Zuflucht vor politischer Verfolgung oder sogar als Weg zur Steuerumgehung: Denn für den Kirchenvater Athanasius bedeutete die Einöde einen Ort, in den sich niemals die Steuereintreiber verirrten.
Obwohl ich weit davon entfernt bin zu behaupten, man solle die Menschen der Antike gerade darin zum Vorbild nehmen und vor den Steuern in die einsame Einöde flüchten, bin ich angesichts der Tatsache, dass die schriftlichen und materiellen Hinterlassenschaften der griechisch-römischen Antike insgesamt so facettenreiche und differenzierte Einsichten über das Alleinsein bieten, davon überzeugt, dass es überaus lohnenswert ist, ihnen ein wenig mehr Aufmerksamkeit zu schenken – ganz besonders in diesen Tagen der rasant zunehmenden Vereinsamung und Isolation von Millionen von Menschen.
Der Autor dankt dem Polish Institute of Advanced Studies (PIASt) für die Unterstützung und Frau Clara Stiborek für die Lektüre des Manuskripts.
Erfahren Sie mehr in diesem Titel von De Gruyter
[Title Image by flyparade/iStock/Getty Images Plus]